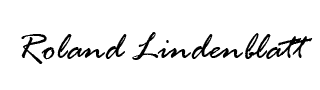Wegen der Corona-Pandemie hat der Staat Rekordschulden gemacht. In den kommenden Jahren muss er riesige Summen investieren – in Infrastruktur, Gesundheit, den Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Wer soll das alles bezahlen?
(Capital Titelgeschichte 09/2021)
Mit Investitionen des Staates, nun, damit kennt sich Julian Leitloff aus. Denn mit ihnen hat er seine Unternehmen aufgebaut, drei insgesamt. Der 32-Jährige, ein junger Mann mit Dreitagebart und dunklen Haaren, geht durch einen Hinterhof in Berlin-Kreuzberg in sein Büro. Ein Rennrad, Telefonboxen, Computer, die übliche Start-up-Kulisse. Leitloff und sechs Mitarbeiter arbeiten hier für Fractal an digitalen Identitätsnachweisen auf Blockchain-Basis, die meisten sitzen in Porto in Portugal.
„Das Geld kommt von privaten und öffentlichen Investoren“, sagt Leitloff. Ohne die wäre es für ihn gar nicht möglich, das Unternehmen aufzuziehen. Sein erstes Unternehmen hat er schon mit 22 gegründet, als er noch zur Uni ging. Geld dafür bekam er von einer staatlichen Beteiligungsgesellschaft. „Wenn es so weitergeht, haben die ihr Geld mindestens verdoppelt“, sagt Leitloff. Doch nicht nur davon profitiert das Land. Leitloffs Unternehmen macht ordentlich Umsatz, zahlt Steuern. Zudem konnte der Unternehmer mit seinen Firmen immer wieder Talente aus aller Welt gewinnen.
Geht es nach Leitloff, könnte Deutschland noch viel mehr tun, um in Wachstumsbranchen zu investieren. „Wir lassen uns immer noch die Butter vom Brot nehmen“, sagt er. Im Gegensatz zu den USA mangele es an Wagniskapital, daher müsse auch der Staat einspringen.
Und dann das Internet! „Das Glasfaserkabel hat es leider noch nicht bis in den Innenhof geschafft.“ Überhaupt die Digitalisierung. „Wir haben Leute, die wir für einen halben Tag freistellen, damit sie ihren Wohnsitz anmelden können.“
Es ist eine Geschichte, wie sie überall spielen könnte in Deutschland und die eine große Frage berührt: Wie viel können und sollen wir investieren? Es ist eine Frage, die seit Jahren über dem Land schwebt, über die nun wieder mehr diskutiert und gestritten wird – weil Deutschland vor einer wichtigen Wahl steht. Und dabei geht es, wie so oft, um Ideen und Programme, um Wagnisse und Weichen, die gestellt werden. Vor allem aber geht es ums Geld.
In der Pandemie hat der Staat Rekordschulden auf sich geladen, allein der Bund 2020 rund 275 Mrd. Euro, bis Ende 2022 werden es wohl rund 470 Mrd. Euro. Gewaltige Summen, die nötig waren – die der Staat nun aber zurückzahlen soll. Dabei liegen ebenso gewaltige Summen noch vor uns. In den kommenden Jahren muss Deutschland investieren, vor allem in Straßen, Schienen, Schulen und den Umbau der Wirtschaft, damit diese Stück für Stück klimaneutral produzieren kann.
Von einem „Schicksalsjahrzehnt“ sprechen die Grünen, von einem „Modernisierungsjahrzehnt“ die CDU. Egal wie man es nennt: Es muss investiert werden. Man könnte auch sagen: Dreistelliges war nötig, Dreistelliges wird nötig. Die Pandemie präsentiert uns eine große Rechnung, die Zukunft mit ihren großen Trends ebenfalls. Bloß: Wie finanzieren wir das alles? Wer zahlt? Natürlich gibt es viele Vorschläge dazu, im Kern aber sind es drei Wege: höhere Steuern, neue Schulden – oder einfach Wachstum, was hieße: aus dem laufenden Geschäft.
#1 Der Verlust der Zahlen
„Klar, wir müssen von diesen großen Zahlen runter.“ Der Mann aus dem Finanzministerium nickt. Haben ja alle Respekt vor diesen Summen gehabt, haben sie immer noch! Es gab Tage, da haben die Beamten die immer neuen Corona-Hilfen in Grundrenten-Kosten umgerechnet. Wie lange wurde um die Grundrente gestritten und gerungen zwischen Union und SPD! 1,3 Mrd. Euro kostet sie den Steuerzahler in diesem Jahr. Was sind heute 1,3 Milliarden? Gefühlt: ein fiskalischer Wimpernschlag. Es ist weniger, als 2020 für eine Woche Lockdown veranschlagt wurde.
Die Corona-Pandemie wird auch als eine Zeit in die Geschichte eingehen, in der sich die Recheneinheiten verändert haben. Zählte man Kurzarbeiter vor der Krise in Zehntausenden, wurden es Millionen. Stritt man davor noch über Hunderte Millionen oder einige Milliarden, wurden die Milliardenbeträge jetzt oft zwei- oder gleich dreistellig. Die Amerikaner, die in der Finanzkrise noch vor einem Billionenprogramm zurückschreckten, rechnen nur noch in Billionen. Noch 2019 mahnte Finanzminister Olaf Scholz: „Nun sind die fetten Jahre vorbei.“
Im März 2020 holte er die Bazooka raus, im Sommer sein „Wumms“-Paket für die Konjunktur und Zukunftsinvestitionen: in Wasserstoff, Breitband und E-Mobilität. Allein das Volumen: 130 Mrd. Euro, finanziert auf Pump.
Es herrscht Konsens unter Ökonomen, dass diese Schulden notwendig, ja unvermeidbar waren. Es waren bittere Schulden, weil sie oft nur Wertschöpfung ersetzen mussten, die im Lockdown stillgelegt war. Ebenso aber herrscht Konsens, dass es in diesen Dimensionen nicht weitergehen kann. Von „unkontrollierten Ausgabenwellen“ sprach die FDP, auch CDU-Politiker gestehen im Bundestag bei Haushaltsberatungen: „Diese Zahlen erschrecken.“
Die Verschuldung des deutschen Staates entwickelte sich seit dem Zweiten Weltkrieg kontinuierlich, wuchs aber manchmal auch in Wellen: die Konjunktursteuerung in den 1970ern, die deutsche Einheit ab 1990, die Finanzkrise ab 2009 – und dann die Pandemie. 650 Mrd. Euro neue Schulden werden es in den Jahren 2020 bis 2022 sein, Ende vergangenen Jahres summierten sich die Gesamtschulden auf 2,2 Billionen Euro, gut 70 Prozent der Wirtschaftsleistung. 2022 werden es voraussichtlich 75 Prozent sein, vor der Pandemie waren es unter 60 Prozent.
Auf die neue Regierung kommt ein Problem zu: Derzeit gibt der Bund in einer Art Ausnahmezustand das Geld aus, das er sich großzügig bis Ende 2022 genehmigt hat. Ab 2023 greift dann wieder die Schuldenbremse, nach der die Neuverschuldung des Bundes nur noch 0,35 Prozent des BIP betragen darf, rund 10 bis 15 Mrd. Euro. Gleichzeitig sollen die Corona-Schulden zurückgezahlt werden, für den Bund zwei Milliarden ab 2023, der Betrag steigt bis 2026 auf 20 Mrd. Euro pro Jahr. So steht es im Gesetz. Vorbildlich wirkt das – aber ist es vielleicht vorschnell? Denn die Aufgaben wachsen, der Spielraum schrumpft.
Geht es nach Scholz, sind die Schulden kein großes Problem. „Aus den neuen Schulden werden wir vor allem mit Wachstum herauskommen“, tönte er im Januar. So wie Deutschland es schon einmal geschafft hat. Nicht unbedingt durch Tilgung, sondern indem die Schuldenquote sinkt, weil die Wirtschaft wächst. Doch so leicht wird es diesmal nicht.
#2 Es gäbe etwas zu holen
Ralph Suikat hat einen Wunsch. Er würde gerne mehr Steuern zahlen. Suikat ist Mitte 50 und Millionär. Im Zoom-Call lehnt er entspannt in seinem Stuhl, im Homeoffice in Ettlingen bei Karlsruhe. Die Sonne scheint ihm ins Gesicht.