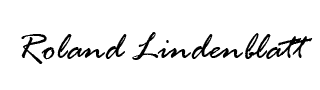Helene Amalie Krupp und Aletta Haniel wurden früh zu Witwen. Sie übernahmen die Geschäfte ihrer Männer, bauten sie aus – und schufen so die Grundlagen für drei Weltkonzerne
(Capital 02/2021)
Der Aufstieg des Ruhrgebiets zum Industriezentrum Deutschlands beginnt mit zwei Frauen und einer Ladung Kaffee. Es ist 1796, und fünf Ballen Kaffee – fast eine halbe Tonne – müssen es irgendwie um die Welt schaffen: über die Ozeane zu den Häfen Europas bis in ein Geschäft am Essener Flachsmarkt. Und das just zu einer Zeit, in der Frankreich sich unter Napoleon halb Europa einverleibt und viele Handelswege versperrt sind. Diesen Transport zu organisieren erfordert äußerstes Geschick und verlässliche Handelspartner. Vielleicht bedient sich die Essener Kauffrau Helene Amalie Krupp im April 1796 auch deswegen der Dienste einer erfahrenen Spediteurin aus Ruhrort. Ihr Name: Aletta Haniel.
Die Transaktion ist einer der ersten Belege für die Geschäfte zwischen zwei Familien, die das Ruhrgebiet in den kommenden Jahrhunderten prägen werden wie wenig andere. Die Krupps und die Haniels werden Zechen errichten, Koks herstellen und in Hochöfen verfeuern, Dampfmaschinen bauen und Tausende Menschen in die Region locken. Und so ähnlich die Geschichten der Industriellenfamilien verlaufen werden, so ähnlich beginnen sie auch: mit zwei Frauen, ohne die es die Unternehmen vielleicht nie gegeben hätte.
Die während der Kriegswirren des 18. Jahrhunderts ihr Vermögen im Speditions- und Kolonialwarenhandel vervielfachen. Die die Zeichen der Zeit erkennen und ihr Geld in Eisenhütten und den Kohlehandel stecken. Und die ihren Kindern und Enkeln das Vermögen und Wissen hinterlassen werden, mit dem sie drei der wichtigsten deutschen Unternehmen der Industrialisierung aufbauen werden: Krupp, Haniel und das spätere Montan- und Maschinenbauunternehmen Gutehoffnungshütte.
Helene Krupp
Als Helene Amalie Ascherfeld 1732 in der 3500-Einwohner-Stadt Essen zur Welt kommt, denkt wohl niemand daran, dass sie einmal eigenes Geld verdienen würde. Warum auch? Ihr Vater, Kaufmann, ist größter Steuerzahler der Stadt, die Familie reich, und Helene damit vor allem: eine gute Partie.
Und zunächst verläuft ihr Leben auch so, wie das Leben einer Frau im 18. Jahrhundert üblicherweise verlaufen sollte: Mit 19 heiratet Helene den wohlhabenden Kaufmann Friedrich Jodocus Krupp, Sohn des Bürgermeisters. Mit 21 bekommt sie ihr erstes Kind, mit 23 ihr zweites. Jodocus führt derweil ein Geschäft im Haus der Familie am Essener Flachsmarkt. Er importiert Kolonialwaren wie Zucker und Tabak aus den Seehäfen der Niederlande, lässt sie Hunderte Kilometer über den Rhein schiffen und auf Karren nach Essen bringen. Wohlhabende in der Gegend lechzen nach den exotischen Waren aus fernen Ländern.
Doch mit 24 wendet sich Helenes Schicksal. Ausgerechnet während des Siebenjährigen Kriegs, als Truppen die Stadt Essen als Durchmarschplatz nutzen und die französische Armee einfällt, stirbt Jodocus. Sie heiratet nicht wieder. Jodocus’ Tod ist stattdessen Helenes Chance, selbst Unternehmerin zu werden.
Schnell wächst Helene in ihre Aufgabe hinein. 1759 gründet sie in Essen als einen der ersten Industriebetriebe eine Schnupftabakfabrik, und spätestens ab 1765, so zeigen es Geschäftsbriefe, führt sie Jodocus’ Geschäft weiter unter dem neuen Namen „Wittib Friedrich Jodocus Krupp sel.“. Das Geschäftsmodell bleibt zunächst das altbekannte: Waren kaufen, verschiffen, verkaufen.
Als Frau muss sie sich unter den männlichen Geschäftspartnern aber erst einmal beweisen; forsch genug sein, um gute Preise zu erzielen, aber freundlich genug, um verlässliche Partner zu finden. Ersteres beherrscht sie: Einmal schreibt sie einem Geschäftspartner in Amsterdam, seine Kaffeebohnen würden stinken, sie könne sie unmöglich verkaufen. Als der keinen Ersatz liefern will, schimpft sie ihn einen Betrüger. Später bricht sie im Streit die Handelsbeziehungen mit einem anderen Geschäftspartner ab. Immer wieder klagt sie in Briefen über schlechte Ware, die zu teuer ist. Sie will nur zum „civilsten Preise“ einkaufen, sie feilscht, verhandelt und vor allem: Sie lässt sich nicht abzocken. Ihr Vermögen wächst so rasch. Schon in den 1770er-Jahren besitzt sie mehr Wiesen, Höfe, Gärten und Häuser, als sie von ihrem Mann geerbt hat.
Wilhelm Gottfried Wiskott, ein Kaufmann aus Dortmund, der 1772 bei Helene eine Lehre macht, ist der einzige Zeitzeuge, der eine Beschreibung ihrer Person hinterlassen hat. Der Historiker Ralf Stremmel, Leiter des Historischen Archivs Krupp, hat sie ausgewertet: Wiskott schildert die „Prinzipalin“, wie er sie nennt, mit einer Mischung aus Respekt und Furcht. Ihr Sohn Peter Friedrich Wilhelm sei gutmütig, doch stehe er völlig im Schatten der Mutter. „Sie löschte Abends das Licht, um Öl zu sparen“, beschreibt Wiskott die asketischen Gewohnheiten, die sie trotz ihres Reichtums pflegt. „Dies ist eine Frau von fünfzigtausend Thaler“, wundert er sich.
Doch obwohl Helene geizig scheint, knallhart verhandelt und forsch auftritt, ist sie stets um gute Kontakte bemüht, anders kann sie im Geschäft nicht bestehen. Auf den Siebenjährigen Krieg folgt nur ein kurzer Friede. In Frankreich toben ab 1789 die Nachwehen der Revolution. Napoleon marschiert im ersten Koalitionskrieg fast unaufhaltsam gen Osten, Truppen versperren die Handelswege, die Gegner erlassen Blockaden. Ohne ihre guten Beziehungen wüsste Helene nie rechtzeitig, welche Wege durch Feldzüge versperrt sind oder ob ein Transport über Land oder Wasser günstiger ist. Dank ihres Geschicks aber läuft das Geschäft besser denn je.
Doch dann marschiert Frankreich 1795 in die Niederlande ein, besetzt nach und nach auch das linksrheinische Gebiet – und gefährdet die Importe aus den Niederlanden. Helene beginnt Korrespondenzen mit Unternehmen in Bremen, Hamburg selbst in London. Nun kann sie auch Güter über norddeutsche Häfen beziehen und auf dem Landweg importieren, den sie jahrelang gemieden hat, weil er schlicht umständlicher war. Nebenbei erweitert sie ihr Angebot, verkauft bald auch Porzellan, Branntwein, Butter und Leinwand.
Aber der Kaffee muss weiter zuverlässig im Geschäft in Essen landen. Und dafür baut Helene auch auf die Dienste einer Frau: Aletta Haniel.
Aletta Haniel
Deren Handelshaus liegt circa 20 Kilometer entfernt in Ruhrort, heute ein Teil von Duisburg. Ihr Betrieb ist vor allem ein Speditions- und Kommissionsgeschäft, transportiert also für Händler Waren wie Kaffee und Wein und schließt Geschäfte auf fremde Rechnung ab. Ruhrort ist ein perfekter Umschlagplatz: Ein Kanal verbindet Alettas Packhaus direkt mit dem Rhein, und zur Landseite hin liegt Ruhrort am Hellweg, einem der wenigen gut ausgebauten Handelswege. Er führt durchs Ruhrgebiet über Essen nach Osten.