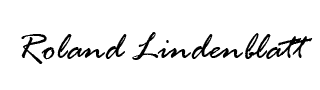Ab 2024 soll jede Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Doch statt des umstrittenen Öl- und Gasheizungsverbots gilt nun Technologieoffenheit: Sind Wasserstoffheizungen dabei eine echte Alternative zu Wärmepumpen?
(Capital+, 30.03.2023)
Ganz oben auf der Liste der Streitpunkte der aktuellen Ampel-Gespräche stand der Gesetzentwurf des Bau- und Wirtschaftsministeriums, der als Öl-und Gasheizungsverbot bekannt wurde. Demnach sollte ab 2024 jede neue Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Um den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor möglichst schnell zu senken, sollte der Einbau elektrischer Wärmepumpen gefördert werden. Der Gebäudesektor verursacht immerhin 40 Prozent der CO2-Emissionen Deutschlands.
Im einem aktuellen Beschlusspapier der Ampel wird zwar weiterhin erwähnt, dass 2024 jede neue Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Dafür ist aber explizit von einem „technologieoffener Ansatz“ die Rede. So könnten theoretisch auch Wasserstoffheizungen eine Rolle spielen, die zuletzt von Jens Spahn in der TV-Talkrunde von Anne Will ins Gespräch gebracht wurden. „Es gibt die ersten Wasserstoffgeräte, da haben Sie die Photovoltaik auf dem Dach, können damit im Keller jeden Tag Wasserstoff produzieren und die Gasheizung behalten“, sagte der CDU-Politiker in der Polittalkshow.
Wasserstoffheizungen versprechen auf den ersten Blick einen geringen CO2-Ausstoß. Dazu ließe sich mit Wasserstoff Energie aus erneuerbaren Stromquellen speichern, bis sie wirklich gebraucht würde. Doch sind Wasserstoffheizungen wirklich energieeffizient und bezahlbar? Und wie schneiden sie im Vergleich zur Wärmepumpe ab?
Dazu lohnt zunächst ein Blick auf die Funktionsweisen. Eine Wärmepumpe nutzt die Wärmeenergie der Umgebungsluft, des Erdreichs oder des Grundwassers. Bei der häufig genutzten Luft-Wasser-Wärmepumpe wird mit Hilfe eines Ventilators die Umgebungsluft angesaugt. Die erhitzt dann ein Kältemittel, das wiederum komprimiert wird, verdampft und so letztlich das Heizwasser aufheizt. Das funktioniert sogar bei Minustemperaturen so gut, dass niemand frieren muss. Allerdings verbraucht die Wärmepumpe dabei Strom.
Wasserstoffproduktion ist energieaufwendig
Eine Wasserstoffheizung hingegen funktioniert eher wie eine herkömmliche Gasheizung. Statt Erdgas wird hier Wasserstoff als Betriebsstoff verwendet. Der produziert bei der Wärmegewinnung keine CO2-Emissionen. Dafür braucht diese Heizung allerdings Wasserstoff. Der kommt entweder aus der Leitung, wenn ein Wasserstoffnetz vorhanden ist, oder der Eigenheimbesitzer stellt ihn selbst her, wie Jens Spahn zuletzt vorschlug. Dafür könnten Hausbesitzer mit Solarstrom über einen Elektrolyseur Wasserstoff produzieren, ihn speichern und später in ihrer Wasserstoffheizung verbrennen. Da Wasserstoff aus der Leitung bisher nur in wenigen Pilotregionen verfügbar ist, arbeiten Herstellern an Geräten, die heute als Gasheizung und in Zukunft als Wasserstoffheizung fungieren können. Herkömmliche Gasbrennwertkessel können das aber nicht.
Für einen Vergleich spielen also nicht nur Kosten und Effizienz einer Heizung eine Rolle, sondern auch die Infrastruktur, Netze, Speicher und so weiter, worauf auch der Energieökonom Lion Hirth von der Hertie School kürzlich in einem Beitrag auf Linkedin hinwies. Dennoch schreibt er, sei es im Kern ganz einfach. Denn: „Mit einer Wärmepumpe macht man aus einer Kilowattstunde Strom rund drei Kilowattstunden nutzbare Wärme. Wenn man die gleiche Kilowattstunde in einem Elektrolyseur zu Wasserstoff umwandelt und dann in einer Gastherme verbrennt, bekommt man nur 0,5 Kilowattstunden Raumwärme“, schreibt Hirth. Die Wärmepumpe sei also effizienter.
Der Grund ist, dass Wasserstoff aus erneuerbaren Energien zunächst produziert werden muss, um ihn dann zu verbrennen. Bei jedem Schritt geht allerdings Energie verloren. Käme der Wasserstoff aus dem Netz, hätte das den Vorteil, dass die gebundene Energie zu jeder beliebigen Zeit für das Heizen genutzt werden könnte. Aufgrund des Energieverlusts bei jeder Umwandlung wäre diese Lösung jedoch nicht effizient. Die Wärmepumpe hingegen kann Strom aus erneuerbaren Quellen wie etwa einer Photovoltaikanlage auf dem Dach direkt nutzen.
Wasserstoffheizung in wenigen Fällen sinnvoll
Einige Studien kommen zu dem gleichen Ergebnis. Laut einer Analyse der Denkfabrik Agora Energiewende sind Wärmepumpen in der Regel effizienter als Wasserstoffheizungen. Die Autoren argumentieren, dass die Nutzung von erneuerbarem Strom für Wärmepumpen deutlich effizienter und kosteneffektiver sei als die Umwandlung von Strom in Wasserstoff, um ihn als Brennstoff zu nutzen. Ein weiterer Vorteil von Wärmepumpen sei ihre hohe Effizienz, da sie bis zu viermal mehr Wärmeenergie bereitstellen könne, als sie elektrische Energie verbrauchen.