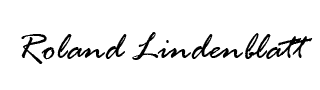Italien, Großbritannien und Frankreich waren zuletzt bekannt für politische Instabilität, Streiks und schwache Konjunktur. Jetzt wächst dort die Wirtschaft anders als in Deutschland. Woran liegt das?
(Capital+, 26.09.2024)
Die Nachrichten zur deutschen Konjunkturentwicklung waren in den vergangenen Monaten von Gefühlen geprägt, die viele Deutsche jahrelang verdrängt hatten: Niederlage und Neid. Schon Anfang des Jahres stellte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fest: „Deutschland fällt zurück, weil das Wachstum ausbleibt“. Wirtschaftsjournalisten schrieben wieder vom „Kranken Mann Europas“ und die Konjunkturprognose des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Mai stand unter dem Titel: „(Fast) alle wachsen, Deutschland nicht.“
Tatsächlich hatte sich in Deutschland über Jahre eine Zuversicht gebildet, besser zu sein als die Anderen. Kein Globalisierungsverweigerer wie Brexit-Britain. Kein ewiger Pleitegeier wie Italien. Kein Dauerstreikland wie Frankreich. Zwischen 2010 und 2019 wuchs die deutsche Wirtschaft im Schnitt um 1,9 Prozent. In der Eurozone lag das Wachstum gerade mal bei 1,4 Prozent.
Inzwischen aber zeigen Prognosen von EU-Ökonomen: Frankreich und Italien können dieses Jahr jeweils knapp ein Prozent BIP-Wachstum erwarten. Laut der britischen Handelskammer sind es für das Brexit-geschädigte Großbritannien 1,1 Prozent. In Deutschland hingegen sagen die Konjunkturforscher des Münchner ifo-Instituts ein Nullwachstum voraus. Wie kann das sein?
Deutschlands Stärken machen es schwach
Zunächst hilft ein Blick darauf, wie solche Prognosen entstehen. Konjunkturforscher berechnen zunächst die Entwicklung einiger messbarer Größen: Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Zinsen, Preisentwicklungen, Investitionen, Aufträge aus dem In-und Ausland und Einigem mehr. Dann schätzen sie, wie politische Entscheidungen über Steuern, Staatsausgaben und das allgemeine Vertrauen in die Politik unternehmerische Entscheidungen beeinflussen könnten.
„Die Grundlagen sind das Wichtigste. Doch wenn die Grundlagen für Wachstum schlecht sind, dann verstärkt die Politik den Effekt“, sagt die Ökonomin Cinzia Alcidi, die beim Centre for European Policy Studies in Brüssel die Abteilung Wirtschaftspolitik leitet.