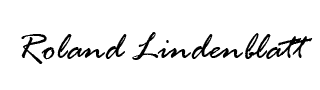Fast nirgendwo sind so viele Menschen in Kurzarbeit wie in Pforzheim. Wie in einem Labor lässt sich besichtigen, was das Instrument kann: Es rettet Jobs. Doch werden auch Unternehmen durch die Krise geschleppt, die eigentlich keine Chance mehr haben
(Capital 12/2020)
An einem Wochenende Mitte März rufen die ersten Unternehmer Martina Lehmann an. Sie wollen wissen, wie sie in Zukunft noch ihre Mitarbeiter bezahlen sollen. Ausgerechnet von Lehmann. Seit mehr als vier Jahren leitet die 57-Jährige die Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim. Vier Jahre, in denen sie selbst immer weniger Mitarbeiter beschäftigte, weil die Betriebe der Region immer mehr einstellten. Vier Jahre, an deren Ende, im März, die Arbeitslosigkeit hier bei 3,5 Prozent lag. Vier Jahre, in denen Unternehmen meist nur von ihr wissen wollten, wie sie genug Fachkräfte finden.
Doch plötzlich ist alles anders: Nachdem Baden-Württemberg in jenen Märztagen beschließt, wegen der Corona-Pandemie die meisten Geschäfte und Hotels dichtzumachen, sind viele verunsichert, wie es weitergehen soll. 700 weitere Anrufe erhält die Agentur am folgenden Montag. Um die Anfragen zu bearbeiten, verlängert Lehmann die Arbeitszeiten ihres Teams deutlich: von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr kümmert sich immer jemand. Hunderte Male antworteten die Mitarbeiter den Anrufern das Gleiche: Sie sollten Kurzarbeitergeld beantragen.
778 Anzeigen zur Kurzarbeit bearbeitet Lehmanns Team im März. 4781 weitere im April. 6067 insgesamt bis Ende Mai. Im Mai sind in der Region Nagold-Pforzheim mehr als 53.000 Beschäftigte in Kurzarbeit – von insgesamt 220.000 Arbeitnehmern.
In kaum einer Region sind Arbeitnehmer in der Corona-Krise so flächendeckend in Kurzarbeit geschickt worden wie hier rund um Pforzheim. Die Idee der Kurzarbeit ist ja auch sehr einleuchtend: Damit Unternehmen in einer Krise keine Mitarbeiter entlassen, übernimmt die Arbeitsagentur zeitweilig einen Teil ihres Gehalts und der Sozialversicherungsbeiträge. 2009 etwa hat das hier im Nordschwarzwald gut funktioniert, damals lag die Arbeitslosenquote nach der Finanzkrise nicht einmal einen Prozentpunkt höher als 2007.
So soll es auch diesmal kommen. Und einerseits scheint es im Herbst 2020 so, als ob Deutschland mit Kurzarbeitergeld, Ausnahmen im Insolvenzrecht und massiven Unterstützungszahlungen die Wirtschaft leichter pausieren könnte als andere Länder. Andererseits aber fürchten Kritiker, dass nun Unternehmen durch die Krise geschleppt werden, die langfristig gar keine Chance mehr haben. In einer Umfrage des Ifo-Instituts unter 120 Ökonomen sorgte sich die Hälfte von ihnen, dass die Ausweitung des Kurzarbeitergelds auf 24 Monate zur Entstehung solcher Zombieunternehmen beitragen könnte: Arbeitnehmer blieben in Jobs, die es ohne Hilfen nicht mehr gäbe, während ihre Arbeitgeber die Pleite hinauszögerten.
Ist die Kurzarbeit also ein Segen in der Krise – oder eine Falle? Wer einen Eindruck davon bekommen will, wie gut oder schlecht Kurzarbeit die deutsche Wirtschaft durch die aktuelle Lage tragen kann, der ist in Pforzheim genau richtig.
Freitags frei
Patrick Stöber ist ein gutes Beispiel. Der 53-Jährige mit den ergrauten Locken leitet den Maschinenbauer Stöber, 850 Mitarbeiter weltweit, 550 davon in Pforzheim. Stöber stellt Motoren, Getriebe und die zugehörige Elektronik her, die dann in Werkzeugmaschinen für die Automobilbranche, Deckenventilatoren oder Holzschnittmaschinen verbaut werden.
Der Chef ist gerade auf dem Weg zur Produktionshalle, wenige Hundert Meter von seinem Büro entfernt, streift dort eine Art Sicherheitspantoffel über seine Lackschuhe und drückt die Türe auf. Hunderte Bauteile sind dort nebeneinander auf den Werkstischen aufgereiht. Doch sonst ist es ziemlich leer. Seit der Corona-Krise ist die Nachfrage um 20 Prozent eingebrochen, Stöbers Angestellte arbeiten seit April 20 Prozent weniger. Die meisten bleiben freitags schlicht zu Hause.
Wann es hier wieder aufwärtsgeht, hängt an der Weltkonjunktur. 65 Prozent seines Umsatzes macht Stöber mit Exporten, viele Branchen, viele Nationen. Das ist derzeit auch ein Glück, denn selbst wenn eine davon schlechter aus der Krise kommt als andere, bleiben noch Kunden. Zurzeit boomt beispielsweise der Bau von Holzhäusern, sodass Stöber mehr Antriebe für Holzschnittmaschinen verkauft. Sorgen bleiben trotzdem.
„Leute entlassen ist das Letzte, was ich will“, sagt Stöber. Er spricht über Verantwortung und die Familien der Mitarbeiter. Aber natürlich steckt auch betriebswirtschaftliches Kalkül dahinter: Neue Leute sind schwer zu finden, und Stöber muss sie monatelang einarbeiten.
Für Unternehmen in Stöbers Lage wurde Kurzarbeit gemacht. Dazu, vorübergehende Krisen zu überbrücken. In der Finanzkrise etwa haben die Deutschen auch dank der Kurzarbeit seltener ihre Jobs verloren als Bewohner anderer Länder. Kurzarbeit funktioniert dort besonders gut, wo sie Unternehmen hohe Kosten durch Entlassungen und Einstellungen erspart. Die sind in Deutschland ohnehin hoch und steigen mit der Spezialisierung der Arbeitnehmer noch weiter.
Die Überbrückung hilft so nicht nur einzelnen Unternehmen, sondern der gesamten Volkswirtschaft. Almut Balleer, Professorin für Empirische Wirtschaftsforschung an der RWTH Aachen, hat festgestellt, dass Kurzarbeit auch größere Schwankungen des Bruttoinlandsprodukts verhindert. Die Angestellten, die ihre Jobs eben nicht kurzfristig verlieren, können außerdem weiter Geld ausgeben. Und sie haben vor allem eins: viel Zeit dazu.
Thorsten Merker etwa leitet die Filiale der Baumarktkette Hornbach in Pforzheim. Im Poloshirt, halb orange, halb schwarz, steht er gerade auf dem Kundenparkplatz, groß genug für Hunderte Autos, und deutet zur Einfahrt. „Bis dahin haben die Leute gestanden. Das war wie im Europa-Park, wenn sie sich am Fahrgeschäft anstellen“, sagt er.
Als die Corona-Maßnahmen im Frühjahr das öffentliche Leben lahmlegten, gingen bei ihm die Umsätze durch die Decke. Von April bis Juni hat sein Markt beispielsweise doppelt so viele Dachlatten verkauft wie 2019. „Es gab wirklich Kunden, die sagten, sie brauchen Dachlatten, um ihre Fenster zu verbarrikadieren. Die hatten Angst vor Plünderungen“, sagt Merker und schmunzelt. Seither gingen aber vor allem mehr Grills, Blumenerde und Farbe über das Band als in anderen Jahren. „Die Leute wollen es sich zu Hause eben schön machen“, sagt Merker.
Die andere Seite der Kurzarbeit allerdings: Während die Lkw mit Warenlieferungen fast doppelt so häufig kamen wie sonst, arbeitete Merker oft bis in die Nacht. „Wir haben dringend Kassierer gesucht. Wir dachten, dass wir von Bewerbern überrannt werden, weil ja auch die Gastronomie nicht öffnen konnte. Am Ende mussten wir aber auf Leiharbeiter zurückgreifen.“
Normalerweise suchen in einer Krise Hunderttausende dringend einen neuen Job. Doch wer in Kurzarbeit ist, muss das nicht – und so kann es für Unternehmen schwerer werden, offene Stellen zu besetzen. Merker konnte sich für vergleichsweise einfache Arbeiten mit Leiharbeitern aushelfen. Doch es ist ein Phänomen, das Ökonomen fürchten: Je länger das Kurzarbeitergeld gezahlt wird, desto eher besteht die Gefahr, dass es Arbeitnehmer in Jobs hält, in denen sie eigentlich nicht mehr gebraucht werden – während andernorts begehrte, qualifizierte Mitarbeiter fehlen. Die gesamte Wirtschaftsleistung bleibt so unter ihren Möglichkeiten. Der Ökonom Pierre Cahuc etwa, Professor an der Sciences Po in Paris, hat genau das nach der Finanzkrise in Frankreich beobachtet, wo der Zugang zum Kurzarbeitergeld lange über die eigentliche Krise hinaus erleichtert wurde.
So weit, so bedenklich. Es kommt jedoch noch hinzu: Heute ist vieles anders als in der Finanzkrise.
Wenn etwa Frau Lehmann von der Arbeitsagentur erklären will, wie sich die Lage 2020 von der 2009 unterscheidet, zieht sie eine Grafik mit bunten Balken und Linien aus ihrer Mappe. „Struktur, Konjunktur und Corona überlagern sich“, steht darüber. Heißt: Es gibt derzeit nicht nur ein Problem, sondern mehrere. Lehmann sagt: „Wir haben den Transformationsprozess in der Automobilindustrie. Wir haben Brexit und Handelskrieg. Wir haben die Digitalisierung.“ Kurz: Die Wirtschaft verändert sich ohnehin gründlich – und obendrauf kommt mit Corona ein zusätzlicher Schock für die Weltkonjunktur, der die Wirtschaftsstruktur weiter auf den Kopf stellen könnte.