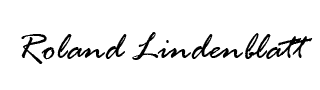Die Menschheit müsste weniger Fleisch essen. Oder das Fleisch neu erfinden. Start-ups wie SuperMeat aus Israel züchten es im Labor
(Capital 10/2021 mit Zulieferung aus Israel von Mareike Enghusen)
Es war ihr erster Burger seit mehr als 20 Jahren. Chaya Beili, 61-jährige Israelin, Tierschutzaktivistin und überzeugte Veganerin, blickt auf die Krümel auf ihrem Teller. Mehr ist nicht übriggeblieben von ihrem Chicken-Burger. „Lecker“, sagt Beili. Allein das Aroma habe sie am Anfang etwas irritiert. „Das ist wirklich der Geruch von Hühnerfleisch.“
Dass Hühnchen nach Hühnchen riecht, ist keine Selbstverständlichkeit in diesem Restaurant in Rehovot, einer Stadt südlich von Tel Aviv. Zwar nennt sich der Laden The Chicken. Doch das Fleisch, das hier zwischen Brötchenhälften und als Füllung vietnamesischer Frühlingsrollen serviert wird, stammt nicht von toten Tieren, sondern aus einem Edelstahltank im Nebenraum.
The Chicken gehört zum israelischen Start-up SuperMeat, das Fleisch im Labor züchtet. Auf den ersten Blick sieht man das dem Restaurant nicht an. Drei kleine Rundtische, dazu eine Bar, hinter der zwei junge Männer in schwarzen Schürzen Burger belegen, Gin-Tonic mixen und Wein ausschenken. Im Hintergrund läuft US-Pop. The Chicken könnte ein gewöhnliches Tel Aviver Boutique-Restaurant sein – wäre da nicht das Labor, das hinter einer Glaswand gegenüber der Theke liegt. Dort stehen ein kühlschrankähnlicher Bioreaktor, diverse Maschinen mit blinkenden Anzeigen und mächtige Edelstahltanks.
Ein Mitarbeiter im blauen Kittel klettert per Leiter an einem der Tanks hoch, öffnet den Deckel und kippt aus einer Dose weißes Pulver hinein. „Das ist sozusagen das Futter“, sagt Ido Savir, der 42-jährige Gründer und CEO des Start-ups. Es bewirkt, grob gesagt, dass aus Hühnereizellen echtes Fleisch heranwächst. Das Wachstum sei exponentiell, erklärt Savir, die Masse verdopple sich alle paar Stunden. „Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, kann man täglich ernten. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Schar von 100.000 Hühnern – und am nächsten Tag sind es 200.000. Darin liegt das industrielle Potenzial dieser Technologie.“
Eine Revolution
Große Hoffnungen ruhen auf dem „kultivierten Fleisch“, wie seine Hersteller es nennen. Weltweit werden derzeit rund 50 Milliarden Hühner pro Jahr geschlachtet. Ließe sich das Fleisch im industriellen Maßstab künstlich herstellen, wäre es eine Revolution für die gesamte Ernährungsindustrie, denn die Technik lässt sich auf fast jedes Tier anwenden: Schwein und Rind, aber auch Lachs und Forelle könnten theoretisch aus dem Bioreaktor kommen.
Das Laborfleisch, so Savirs Hoffnung, hätte nicht nur das Potenzial, Tiere zu schonen, sondern auch die Umwelt. Denn bis 2050 werden voraussichtlich 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben, die nach einer UN-Schätzung doppelt so viel Fleisch essen werden wie die Menschheit heute. Fleisch, für das pro Kilo je nach Sorte zwischen dreimal und 13-mal so viel Kilo an Tiernahrung verfüttert werden müssen. Fleisch, das deshalb schon heute 70 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen für Weiden und Futterproduktion beansprucht und für etwa 15 Prozent der menschgemachten Treibhausgase verantwortlich ist.
Wie das Laborfleisch im Vergleich abschneidet, ist noch nicht ganz klar. Doch Wissenschaftler des Forschungsunternehmens CE Delft haben zuletzt errechnet, dass bei industrieller Produktion ein Kilo Nährstoffe plus Wasser ausreichen würde, um in etwa dieselbe Menge an Fleisch zu gewinnen. Die klimatischen Auswirkungen wären damit wesentlich geringer als bei der herkömmlichem Fleischproduktion, vorausgesetzt die Energie zur Produktion des Zellfleischs käme aus erneuerbaren Quellen.
Immer bessere Imitationen
Das Laborfleisch könnte dann fortsetzen, was mit Burger-Bratlingen aus Erbsenhack und Rote-Bete-Saft begann: Je besser die Imitationen werden, desto eher dürften sich auch hartgesottene Fleischfresser von einer tier- und klimafreundlichen Ernährung überzeugen lassen. Dazu müssen die Ersatzprodukte dem Original so nahe wie möglich kommen – im Geschmack, beim Aussehen und beim Preis. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das Zellfleisch das Zeug dazu hat.
Die Gäste in Savirs Restaurant wirken jedenfalls überzeugt. „Schmeckt genau wie Chicken-Nuggets“, sagt die 32-jährige Schwedin Freja Forslund. Sie verzichte aus moralischen Gründen immer öfter auf Fleisch, fügt sie hinzu. „Aber ich vermisse es. Ich würde es gern weiter essen, wenn es eine ethischere Art gäbe, es zu produzieren.“
Besonders junge Menschen wie Forslund sind offen dafür, das neue Fleisch zu probieren. Bei einer Umfrage der Universitäten Bath und Arizona State in Großbritannien und den USA gaben das 85 Prozent der Befragten in der Altersgruppe zwischen 25 und 40 an. Die noch Jüngeren sind sogar noch offener dafür. In Deutschland sind laut zwei anderen Studien immerhin rund 60 Prozent zum Ausprobieren bereit, ein Drittel würde sogar regelmäßig Kunstfleisch kaufen.
Offen blieb bei allen Umfragen dieser Art bisher, ob die Befragten bei ihrem Urteil bleiben, wenn sie das Kunstfleisch erst einmal probiert haben. Ido Savir und seine Kollegen sind mit die Ersten, die das nun testen können. Ihr Restaurant haben sie im Oktober 2020 eröffnet, doch wegen der Pandemie durften sie erst mal keine Gäste empfangen. Wer nun kommen möchte, muss sich auf ihrer Website bewerben. Um die 20.000 Menschen aus aller Welt haben das bisher getan, berichtet Savir. Wer einen Platz ergattert, zahlt nichts, das Restaurant dient vorerst als Marketing- und Marktforschungsinstrument. „Hier bekommen wir von den Gästen direktes Feedback“, sagt Savir.
The Chicken dürfte den Gästen ohnehin nichts berechnen, da Israel noch keine Richtlinien für den Verkauf von Laborfleisch erlassen hat. Es ist die Frage, von der bisher noch die ganze Branche abhängt: Werden die Behörden das Fleisch zulassen?
In Europa dürfte das noch etwas dauern. „Das kultivierte Fleisch müsste den Novel-Foods-Prozess der EU für neuartiges Essen durchlaufen“, sagt Elena Walden von der Nichtregierungsorganisation Good Food Institute (GFI). Damit prüfe die europäische Lebensmittelbehörde vor allem, ob neue Nahrungsmittel gesundheitsschädlich seien. Mindestens neun Monate dauere das, realistisch seien aber eher anderthalb bis zwei Jahre, sagt Walden. Bisher habe sich allerdings niemand um eine Zulassung in der EU bemüht. In den nächsten zwei Jahren kommt das Laborfleisch in Europa voraussichtlich also nicht auf den Tisch. Unrealistisch ist die Zulassung aber keineswegs.
…