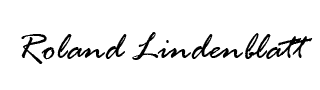(Stern 08/2022, mit Stefan Schmitz)
Stern: Frau Shafik, wie haben Sie die Pandemie als Direktorin der London School of Economics erlebt?
Minouche Shafik: Wir konnten uns aufeinander verlassen in unserem Mikrokosmos. Alle trugen ihre Masken. Wer an der Uni war, hat sichdauernd testen lassen. Wer infiziert war, hat sich isoliert.
Ist das nicht etwas, das wir alle gelernt haben?
Teilweise schon. Aber im Großen konnten sich die Menschen nicht aufeinander verlassen. In den wohlhabenden Ländern der Welt sind die meisten Menschen geimpft, im Rest der Welt nicht. Wir waren nicht nur unsolidarisch, sondern haben auch noch ein perfektes Umfeld für die Verbreitung des Virus und die Entstehung neuer Varianten geschaffen. Die Pandemie ist das schlechteste Beispiel internationaler Zusammenarbeit, das ich in meiner Laufbahn erlebt habe.
Auch innerhalb von Gesellschaften war die Last ungleich verteilt.
Ja, alte Menschen, junge Menschen und solche in prekären Arbeitsverhältnissen haben am meisten gelitten. Die Zeit hat bei vielen ein Gefühl der Unsicherheit verstärkt, das es schon vor der Krise gab und das wir sehr ernst nehmen müssen: Große Teile der Bevölkerung entfernen sich immer weiter von Staat und Gesellschaft, weil sie sich nicht mehr aufgehoben fühlen.
Woher kommt diese Verunsicherung?
Vor allem daher, dass die Welt sich rasend schnell verändert hat, aber der Gesellschaftsvertrag damit nicht Schritt gehalten hat – also die Vorstellung davon, was wir einander schulden, was der Einzelne zu regeln hat und wo er sich auf die Gemeinschaft verlassen kann.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Bleiben wir bei den prekären Arbeitsverhältnissen: In vielen Teilen der Welt, auch in Deutschland, ist die Zeit vorbei, in der ein junger Mann oder eine junge Frau nur einmal eine Ausbildung machen musste und dann ein Leben lang eine sichere, gute Arbeit hatte. Das schafft Unsicherheit. Daher erwarten die Menschen mehr Fürsorge von staatlicher Seite.
Aber bekommen sie diese Fürsorge denn nicht? Gerade in der Pandemie hat es immense Förderungen gegeben.
Das stimmt. Aber es geht hier nicht um kurzfristige Geldspritzen. Das Fundament bröckelt. Ein Mensch muss im Leben mit vielen Risiken fertig werden: dem Risiko, wer sich um einen kümmert, wenn man älter wird, wer sich um kleine Kinder kümmert oder wie lange man seinen Job noch machen kann. Unser heutiger Gesellschaftsvertrag bietet den Menschen bei diesen Risiken nicht genug Sicherheit. Er ist noch auf das 20. Jahrhundert ausgelegt.
Was war denn im letzten Jahrhundert so viel anders als heute?
In den meisten Familien haben die Frauen sich damals um die Kinder und die Alten gekümmert. Der Mann hat das Geld verdient. Und das in einem Beruf, für den er in jungen Jahren ausgebildet wurde und dem er ein Leben lang nachgehen konnte.
Worin bestehen heute die Herausforderungen?
Es fängt schon bei der Familie an. In einigen Industrieländern wird die Hälfte aller Ehen geschieden. Immer mehr Frauen arbeiten. Kinder und Alte können oft nicht mehr wie früher in der Familie betreut werden. Außerdem ist die Lebenserwartung so stark gestiegen, dass viele Menschen Jahrzehnte im Ruhestand verbringen. Immer mehr Rentner treffen auf immer weniger Arbeitende. Und die haben auch nicht mehr so sichere Arbeit wie früher. Durch Globalisierung und technischen Fortschritt sind viele Menschen auf der Welt zwar wohlhabender geworden. Doch die sicheren Produktionsjobs der
Mittelschicht, die es lange in den alten Industrieländern gab, werden immer weniger.
Das sind ja nicht unbedingt neue Erkenntnisse.
Nein. Aber in den meisten Industrieländern verhalten wir uns so, als hätte sich die Welt nicht geändert.
Eine Ihrer zentralen Forderungen lautet, Menschen im fortgeschrittenen Alter bei der Ausbildung zu helfen. Ist es nicht eine Illusion, dass alle eine Chance haben, neue Arbeit zu finden, wenn ihre alte wegfällt?
Ich glaube, dass jeder einen Beitrag leisten kann, auch wenn damit manchmal vielleicht kein auskömmlicher Lohn verbunden ist und die Person zusätzlich Unterstützung braucht. Vielleicht müssen wir auch neue Jobs erfinden. Wir könnten Menschen bezahlen, damit sie Heimbewohnern Gesellschaft leisten, die sonst niemanden haben.
Wie lange sollen die Menschen denn arbeiten?
Zunächst einmal länger als heute. Die Menschen werden immer älter, aber das Renteneintrittsalter stagniert in vielen Ländern. So war das System aber nicht gedacht. Denken Sie an Bismarck. Als der Ende des 19. Jahrhunderts die Rentenversicherung einführte, betrug das Renteneintrittsalter 70 Jahre. Wer es erlebte, bekam in der Regel ein paar Jahre Rente. Heute verbringen die Menschen in den OECD-Ländern ein Drittel des Erwachsenenlebens in Rente. Das ist nicht finanzierbar. Bismarck würde sich im Grab umdrehen.
Wie möchten Sie das ändern? Man ist ja nicht ewig fit und kann nicht unendlich lange arbeiten.
Die Gesundheitsforschung zeigt, dass sich die Anzahl der Jahre, in denen man am Ende des Lebens krank ist, nicht stark verändert hat. Früher wurde man 70 Jahre alt, und in den letzten vier oder fünf Jahren war man vielleicht nicht mehr sehr gesund oder arbeitsfähig. Jetzt wird man 80 Jahre alt. Und wieder sind es die letzten fünf Jahre, in denen man arbeitsunfähig ist. Also kann man bis 75 arbeiten.
An eine echte Rentenreform traut sich keine große Partei. Ist das nicht verständlich, wenn auch die Wähler im Schnitt immer älter werden?
Dass unsere Wahlsysteme so sehr von alten Menschen dominiert werden, ist eine große Herausforderung für solche Reformen. Da gebe ich Ihnen recht. Aber es ist nicht fair, von unseren Kindern zu verlangen, dass sie hohe Steuern zahlen, um unsere Gesundheitsversorgung und unsere Renten zu finanzieren. Das muss man den Älteren klarmachen.
Sie sagten, dass die Menschen nach der Pandemie mehr Unterstützung von der Gesellschaft verlangen. Ist das eine Chance, dass Ihre Vorschläge umgesetzt werden?
Das lässt sich schwer sagen. Aber es ist eine Umbruchsituation wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Gute Voraussetzungen also für einen grundsätzlichen Neuanfang. Für mich ist klar erkennbar, dass jetzt der Wandel kommen muss, um die Grundlagen freier und offener Gesellschaften neu zu bestimmen. Nur so können wir sie verteidigen.